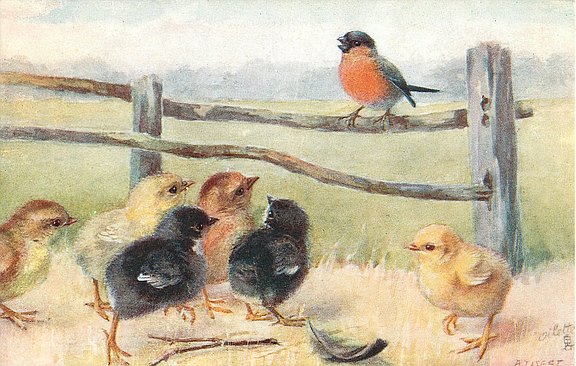- Startseite
- Erinnerungen
- Glückliche Kindheit im Waisenhaus
Glückliche Kindheit im Waisenhaus
- Autor: Erhard Schaeffer
- Zeit: 1916
- Ort: Bettenhäuser Straße
- Vom: 18.04.2023
- Themen: Jugend- und Kindheitserinnerungen, Schulen und Kindergärten
Emilie Wilhelm mit ihrer Puppe "Rosa"
Foto: Stadtmuseum Kassel, um 1919 (verbessert mit künstlicher Intelligenz)
Emilie Wilhelm notierte im Advent 1978 Eindrücke aus ihrer Kindheit. Sie war die Tochter von Heinrich Wilhelm, einem tüchtigen Handwerker, der als Waisenjunge aufgewachsen war. Sein Vater war tödlich verunglückt und von seiner Mutter sagte man, dass sie sich »totgearbeitet« habe. So wurde Heinrich als Neunjähriger um 1880 aus seinem Rhöndorf ins Reformierte Waisenhaus nach Kassel gegeben. Niemand hatte damals über das Leben in einem solchen Heim eine klare Vorstellung. Als aber Heinrich in den Ferien zu seinem Vormund zurück ins Dorf kam, soll er berichtet haben: »Groß wie ein Schloss ist das Haus und der Garten reicht bis an den Himmel.« An diese Worte erinnerte sich Emilie Wilhelm, als sie im Alter von 67 Jahren »ein paar Seiten eines Bilderbuches« aufschlug, um von ihrer »glücklichen Kinderzeit« zu berichten. Sie dachte dabei an die Jahre, in denen auch sie im Reformierten Waisenhaus zu Kassel gelebt hatte. Das hatte sich ergeben, weil ihr Vater dort eine Anstellung als »Werkführer« gefunden hatte und damit an dem Ort für Ausbildung und Freizeitgestaltung junger Menschen mitverantwortlich geworden war, in dem er selbst wichtige Jahre seiner Kindheit verbracht hatte. Vater Heinrich bezog für dieses neue Amt samt Ehefrau und den Kindern Friedrich und der fünfjährigen Emilie eine Dienstwohnung im Reformierten Waisenhaus. Emilie genoss einen privilegierten Status, weil zwischen 1848 und den 1920er Jahren im Waisenhaus wegen finanzieller Engpässe keine Mädchen aufgenommen wurden. Sie beobachtete den Alltag der Waisenkinder und nahm sogar im 1. Schuljahr am häuslichen Unterricht teil. Als Mädchen unter so vielen Jungen fühlte sie sich verwöhnt und sah aus ihrer Kinderperspektive die fantastische Beschreibung ihres Vaters über die Ausmaße von Haus und Garten bestätigt. In ihren Erinnerungen, die im Stadtmuseum Kassel verwahrt werden, nimmt Emilie Wilhelm Bezug auf das alltägliche Leben und die Ausbildung im Reformierten Waisenhaus, schildert Erlebnisse mit Erziehern und Mitbewohnern und beschreibt sorgfältig alle Räumlichkeiten des Anwesens. (Hans-Dieter Credé, Kassel 2015)
Vorwort
Weder eine Abhandlung über Pädagogik vergangener Zeit will ich schreiben, noch die Geschichte einer alten Stiftung, die des »Reformierten Waisenhauses«, sondern für Euch, meine Kinder, nur ein paar Seiten eines Bilderbuches aufschlagen. Schaut’s Euch an. Da geschieht nichts Großartiges und doch das Großartigste, was es für einen Menschen gibt: eine glückliche Kinderzeit!
um 1916–1919
(Vorwort: Emilie Wilhelm, Advent 1978)
Groß wie ein Schloß
Sie erzählte: Die Gegend war sagenumwoben, und die da wohnten, lebten zusammen mit Hulden und Teufeln, aus deren Behausung im Erdinneren stinkende Dämpfe stiegen, mit geheimnisvollem Gewässer, aus dem alles Leben kam, Höhlen, die die Springwurz öffnete und die sich schlossen und Mann und Gespann in der Tiefe versinken ließen.
Das Dorf war klein, gab wenig Nahrung. Drum zogen sie als Händler durch’s Land, die nicht als Erben der kargen Scholle geboren wurden. Weit weg oft. Am liebsten dahin, wo in einem Hafen Schiffe Handelswaren brachten oder sie angeheuert wurden zum harten Dienst hinaus auf Fahrt. Auch ihre großen Geschwister waren weggezogen, lebten und handelten in Hamburg. Sie zeigte mir Bilder von ihnen, wußte nur wenig zu erzählen. Nein, reich waren sie nicht geworden. Mehr als die Lebensnotdurft war wohl nicht vorhanden. – Sie lebte noch zu Haus. Die Mutter erwartete ihren Nachkömmling. Der Vater arbeitete an einem Scheunenbau, ein Stück weit vom Dorf, am Hang, wacholderbewachsen, steinig und steil.
Es war Oktober, ein dunkler Himmel und ziehende Nebel, als einer gelaufen kam zu den zwei Frauen: »Er ist aus dem Gebälk von oben bis auf den Boden gestürzt.« Sie liefen mit dem Boten zur Unglücksstelle. Da lag er auf dem Tragbrett, schon mit gebrochnen Augen und Mutter und Tochter standen ratlos und schmerzgeschüttelt. Die Männer hoben die Trage auf. Es war kein kurzer Weg bis zum Haus. Langsam schritten sie den Hang hinunter. Der Nebel verdichtete sich, hob sich dann wieder in wehenden Schwaden. Wer ging da neben ihnen? Wie ein Schemen, bald wie ein hoher Wacholder, dann wieder an Gestalt verlierend, aber immer dicht neben ihnen – bis zum Haus – da verschwamm die Gestalt im Nebel und die Dämmerhelle des Raumes nahm den toten Vater und die beiden leidgeschüttelten Frauen auf. – Noch beim Zuhören spürte ich das Grauen, den Schmerz, die Hilflosigkeit. – und kurze Zeit später wurde das Kind geboren, ein zierlicher Junge mit hellen Augen und weißblondem Haar. Die erwachsene Schwester blieb bei der Mutter. In beider Hut wuchs nun das Kind. Ich kannte nur die Erzählerin, die Tochter, eine hohe schlanke, blonde Frau, voll Güte und Liebe, der ich mit großer Liebe als Kind anhing, die auch ihrem 20 Jahre jüngeren Bruder allezeit in sorgender, später auch achtungsvoller Liebe entgegenkam.
Wovon die beiden Frauen damals lebten, 1871, ist leicht zu folgern: Allein von ihrer Hände Arbeit. Von der Mutter erzählte man mir, daß sie eine stolze Frau gewesen sei und sehr fleißig. »Annegeter hat sich totgearbeitet«. Was zu dem Anwesen gehörte, weiß ich nicht. Nach dem Tode der Mutter, die das Kind neunjährig zurückließ, sagte man dem Vormund nicht gerade selbstlose Verwaltung des Besitzes nach.
Das Kind kam in ein Waisenhaus. Das war für die Dorf-Bewohner mit allen möglichen Vorstellungen verbunden, sicher nicht gerade fröhlichen. Kam das Kind während der Ferien zum Vormund ins Dorf, gab es viele Fragen, wie groß denn das Haus sei und was dazu gehöre. Das Kind antwortete: »Groß wie ein Schloß ist das Haus und der Garten reicht bis an den Himmel.« Das gab nur Kopfschütteln und trug ihm ein zu lügen. Aber für das Kind aus dem kleinen Anwesen im kleinen Dorf war alles unbeschreiblich groß. Ich kann’s verstehen. Auch für mich galten in früher Kindheit diese Dimensionen. Jetzt könnte ich von der Baugeschichte des Hauses berichten. Wozu? Mit den Kinderaugen gesehen baut sich etwas Lebendiges. Da war die beglückende Weiträumigkeit, das Licht, was durch hohe Fenster fiel, die Vornehmheit des Aufgangs – ja, ich will alles so beschreiben, wie es das Kind sah...
Das Ganze lag so weit am Stadtrand, daß die alte Stadtmauer teilweise die Begrenzung gab. Wollte man in’s Innere des umfangreichen Komplexes, mußte man die »Pforte« passieren, ein in seinen ausgewogenen Maßen reizvolles Pförtnerhaus, was ich stets mit Geranien und Fuchsien in den Fenstern in Erinnerung habe. Selten kam ich in das Hausinnere. Eine kleine rotwangige Witwe mit erwachsenen Kindern war Pförtnerin. Ein besonderes Verhältnis zu ihr hatte ich nicht. Vor der Haustür des Pförtnerhauses hing eine Glocke, mit langer Kette zum Läuten. Diese Glocke war für uns Kinder ungemein wichtig. Sie ordnete unseren Tag. Sie ordnete unser Leben. Wenn ich überlege, ist uns diese Ordnung nie lästig gewesen. Ich kann es mir rückblickend nicht anders erklären, als dass Tageseinteilung und Führung bestens durchdacht waren. Jahre später saß ich neben meinem Vater und sah zu, wie er große stabile Bogen mit der Arbeitseinteilung der verschiedenen Gruppen mit seiner sauberen Schrift füllte.
Das Haus hatte seine eigene Schule. Der Unterricht und alles, was dazu gehörte, oblag den Lehrern. Leiter des Hauses war der »Herr Inspektor«, ein gestrenger Herr, aber wir beide mochten uns. Vater ordnete Einsatz im Garten, in den Werkstätten, Buchbinderei, Schreinerei, Schneiderei, Fruchtlesen, d.h. für Firmen wurden Erbsen, Bohnen, Linsen ausgelesen. und die vielen Hausämter, die ein Zusammenleben von 150 Jungen und Personal mit sich bringt.
Ja, diese Treppe!
Durch die Pforte eingetreten – sie war 3türig, die eigentliche Pforte, die ein Glöckchen mit starrem Drahtseil zum Anmelden hatte, ein zweiflügliges Tor und eine Nebentür, zu der nur die Inspektorenfamilie einen Schlüssel besaß, oder meine Eltern, wenn sie spät von Ausgängen zurückkamen, – lag rechterhand das Haupthaus, dreigeschossig mit ausgebauten Dachgiebeln. Eine breite, mit schönem Eisengeländer und mit glänzendem, großblättrigem Weinlaub bewachsene Freitreppe führte zum Eingang. Ja, diese Treppe! Ich wippte auf ihr herum oder hockte auf einer Stufe, schaute den Wolken nach und durchwanderte Traumland, am schönsten dann, wenn an Sommertagen mein Vater abends Dienst hatte und ich bei ihm bleiben durfte. Nach kurzer Abendandacht, zu der er die Jungen unten vor der Treppe versammelte, stob dann alles davon in Waschraum und Schlafsäle. Mit einemmal war es dann ganz ruhig auf der Treppe, und nun hörte ich die Schwalben und schaute ihrem Flug zu. Der Tag war um und randvoll schönem Erleben gewesen, nun die köstliche Stille, der Schwalbenruf, der Duft des Gartens. Ich weiß, daß ich bis heute nie glücklicher war als an solchen Abenden. Dann spürte ich die Hand meines Vaters und sein leises »komm«. – Ob irgendwo noch ein Bild des Haupteingangs existiert? lch kann mich an die schöne Steinmetzarbeit daran erinnern. Die Tür selbst lag etwas zurück und war durch einen Windfang von der Eingangshalle getrennt.

Die Räumlichkeiten
[Die Eingangshalle wurde] von 2 Säulen mit schönen Kapitälen getragen wurde. Eine breite, sich oben verzweigende Treppe führte von der Hallenmitte hinauf. Zwei hohe Fenster gaben dem mit Sandstein ausgelegten großen Raum Licht. Rechts lagen hintereinander 2 Büro-Räume des Inspektors. Die nächsten an die Halle angrenzenden Räume rechts gehörten zu unserer Wohnung, unserem großen Wohnzimmer und einem etwas kleineren Schlafzimmer. Ich erzähle aus der Kinderperspektive, aber die Räume müssen wirklich sehr groß gewesen sein, denn nach einer späteren Zusammenlegung von Mädchen und Jungenwaisenhaus wurde unser Wohnzimmer Anstaltsküche mit Vorratsraum.
Diese, unsere gute Stube, wurde nur, wenn Besuch kam, benutzt. Es war ein schön eingerichteter Raum, in dem es für das Kind manches zu bewundern gab, z. B. den Kopf einer Flora auf einer Jugendstilsäule oder ein Thorwaldsen-Christus aus Alabaster, vor dem ich oft sinnend stand und die ausgebreiteten feinen Hände betrachtete. Ich weiß, daß später eine Zeit für mich war, in der ich zum Kummer meiner Mutter diese »Kunstwerke« Kitsch nannte und verabscheute. Schön und bewundernswert fand ich auch eine silberne Kaffeekanne mit Milchgießer und Zuckerdose auf einem Serviertisch, auch nur zum Gebrauch mit Gästen vorbehalten. Jetzt über 50 Jahre später, sah ich das gleiche Service im Museum in Kassel stehen. Aber das, was ich als Kind damals am schönsten fand, war meines Vaters dunkelpolierter Sekretär, der geöffnet eine Anzahl mit Perlmutt ausgelegter Schubfächer hatte, deren Inhalt für mich geheimnisvoll war. Um den freistehenden hohen runden Gußeisenofen ging ich oft herum und betrachtete seine Verzierungen. Auf dem Sofa saß »Rosa«, meine Sonntagspuppe. Daran aber, daß ich in diesem Zimmer wirklich gespielt hätte, kann ich mich nicht erinnern.
Links vom Eingang lag später der Speisesaal, ein mit 2 Fensterreihen sehr lichter Eckraum. In meiner frühen Kinderzeit war er Garderobe, in der an zweiseitig begehbaren Ständern Ausgehjacken und Mäntel hingen. lm linken hinteren Wandteil der Halle war ein Mützenschrank in die Wand eingebaut und ganz hinten führte ein Türchen in die unter der Treppe gelegene Sandkammer. Feiner hellkörniger Sand lag noch drin, aber damals wurde kein Sand mehr gestreut. Die Tür links neben dem Mützenschrank führte weiter in die Parterreräume, von denen wir noch ein Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche bewohnten.
Ich will aber erst noch weiter vom Vorderhaus erzählen. Von der rechten Abzweigung der Treppe kam man in einen Schlafsaal. An der linken Treppenseite lag ein großer Waschraum mit Reihen von Kippbecken. Dahinter lag noch – immer verschlossen – das »Magazin«, in dessen Regalen Weingläser für Kaisers Geburtstag, Vorrat an Zinnbechern und Tellern und die schönen Zinnleuchter des Weihnachts-Festes aufbewahrt wurden. Wenn ich mich recht erinnere, standen in der Mitte des Raumes hohe Vorratstruhen für Mehl und Zucker. Der Waschraum war von den Schlafsälen des Vorder- und Hinterhauses durch ein Winkeltreppchen gut erreichbar. Geradeaus, also an der Südseite, lagen noch 2 Lehrerzimmer, für mich völlig uninteressante Räume. lm oberen Stockwerk lag rechts die Oberklasse, ein mit Kirschholz getäfelter großer Raum mit Fensterseiten nach Süden und Westen. Diese Oberklasse war durch eine bewegliche Holzwand noch zu vergrößern, wurde dann Festraum. Auch für mich wurde er an unserem Hochzeitstag zum Festraum.
Links an der Treppe lag die Mittelklasse, von mir nicht sehr geliebt. Sie hatte nur eine Fensterreihe zur Stadt hin, ich aber liebte den hellen, getäfelten Raum der Oberklasse mit dem Blick auf die hohen, alten Bäume. Entsprechend zur Oberklasse an der Ost-Süd-Seite lag die Inspektorenwohnung. Dahin kam ich ganz selten mal. Im Giebel befand sich die Unterklasse, kein so hoher Raum wie die übrigen, aber mit vielen Fenstern. Mein 1. Schuljahr habe ich dort mit dem gütigen Herrn Lehrer Bertelmann erlebt. Das ausgebaute Dachgeschoß enthielt noch die Buchbinderei und die Schreinerei, Räume, die ich nur selten aufsuchte. Was dort hergestellt wurde, wurde verkauft, wie, an wen, all das weiß ich nicht. In späteren Jahren nach der Zusammenlegung war im verhältnismäßig weiträumigen Dachgeschoß die Krankenstation. Selten ging ich mit meinem Vater durch die Schlafsäle, ich kann mich nur daran erinnern, daß es eiserne Bettstellen waren und daß über dem bezogenen Bettzeug eine weißgelbe Wolldecke mit roter Kante lag. Einer der Schlafsäle lag im sogenannten Hinterhaus. Da ging ich nie mit hinein. Der miefte. Dort schliefen die Bettnässer. Das »Hinterhaus« lag an der Straßenecke Bettenhäuser Straße / Sternstraße, durch einen gras- und baumbewachsenen Vorgarten etwas von der Straße zurückliegend. Die breite Treppe führte zur zurückgebauten Eingangstür, die immer geschlossen war. Ihr gegenüber, durch breiten Gang getrennt, einige Stufen hinab, lag die »Hintertür«, die immer auf stand und durch die der ganze Verkehr lief. Der rechts vom Eingang gelegene große Speisesaal hatte als Eckzimmer 2 Reihen hoher Fenster, war aber nie so licht, weil die Fenster beiderseits zur Stadt hin lagen, nach Norden zur Sternstraße und nach Osten zur Bettenhäuser Straße.
Ein Engel zu Weihnachten
Nur Weihnachten fand ich den Raum sehr schön. Auf den gedeckten Tischen brannten vielarmige Zinnleuchter. Jedes Kind hatte einen buntgefüllten Zinnteller vor sich, und auf jedem Platz lag auch das bescheidene Weihnachtsgeschenk. Die eigentliche Weihnachtsfeier fand vor Essen und Bescherung in der erweiterten Oberklasse statt und war allemal für mich märchenschön, ja ich weiß, daß ich als kleines Ding einmal ein Engel war, der im Anschluß an die Frohbotschaft das Gebet sprach: »Du lieber, heilger frommer Christ ...« Wir zogen nach dem Essen wieder hinauf zum Weihnachtsbaum und spielten da bis zum Schlafengehen. Wenn ich die Augen schließe, höre ich wieder das Ausprobieren der neuen Mundharmonikas und Trompeten. Die Weihnachtsfeier unserer Familie fand stets erst in der Frühe des 1. Feiertages statt. Später war das dann auch alles ganz anders.
Menschen und Tiere des Hauses
An der Nordfront im Erdgeschoß des Hinterhauses, also neben dem Speisesaal, lag die Küche mit Vorratsraum, unter der Treppe die Milchkammer, deren säuerlich angenehmer Geruch mir im Erinnern noch in die Nase steigt. Ich war selten in der Küche. Dort regierte Frl. D., eine Schwägerin des Inspektors, eine liebe, immer sehr beschäftigte Frau mit 2 Gehilfinnen, dazu dem Küchendienst der Jungen. Frl. D. wohnte im Obergeschoß des Hauses mit ihren zwei Schwestern. Eine war Lehrerin, die andere besorgte den kleinen Haushalt, und diese Schwester habe ich innig geliebt. Sie war fein und still und erzählte mir immer neue Geschichten. Ich war gern bei den älteren Damen, bewunderte die Lehrerin, wenn sie am schwarzpolierten Klavier saß und präludierte. Mitunter besuchte ich auch die Küchengehilfinnen. Sie müssen jahrelang geblieben sein. Ich erinnere mich kaum eines Wechsels, aber ich war sehr glücklich, als mir eine mal aus bunten glänzenden Postkarten ein Puppenbettchen gefertigt hatte. Auf gleichem Gang war die Nachtwächterstube. Zwei Nachtwächter wechselten nächtlich. Sie kamen abends von zu Haus, hatten eine große Lampe und einen Beutel mit Kontrollmünzen, die sie bei nächtlichen Rundgängen in die Kontrolluhren warfen. Ein breiter Lehnstuhl und ein Tisch war das Mobiliar. Ich lief mit Vater morgens die Uhren kontrollieren, die Münzen wieder in das Leinenbeutelchen einsammeln und in die Nachtwächterstube bringen. lm gleichen Stockwerk lag die Früchteleserstube mit 3 langen Tischreihen und Bänken. Die Jungen trugen Leinenschürzen. Da hinein wurden die guten Früchte vom Tisch gelesen, die schlechten an den Rand geschoben und später den Tauben gefüttert, von denen es eine Menge auf dem Dachboden gab. In die Fruchtlesestube durfte ich nicht. Eigentlich war mir sonst kaum etwas verwehrt, aber in den Staub, den es bei der an sich leichten Arbeit gab, ließ mich mein Vater nicht gern.
Auch unsere Vogelstube lag noch im Hinterhaus. Ja, die Vogelstube! Es gab sie nur in meiner ganz frühen Kindheit. In der Mitte stand ein langer Tisch und darauf neben und übereinander Käfige. Hohe Fenster gaben Licht. Ein Wandschrank enthielt Utensilien und Futter. Auf einer schön gedrechselten Stange hatte eine Dohle ihren Platz. »Jakob« konnte sie rufen. Ich liebte das Gezwitschere und bewunderte restlos meinen Vater, der sich regelrecht mit seinen kleinen Freunden unterhielt. Irgendwann war dann meiner Mutter das wöchentliche Auskochen der Käfige zu lästig und Vater trennte sich von seinen Vögeln, aber einen hatten wir immer in der Wohnung. Ein Vögelchen liebten wir besonders, einen Dompfaff, der »Goldene Abend-Sonne« und »Ein Jäger aus Kurpfalz« pfiff. Kam mein Vater zur Tür herein, saß das Tierchen auf seinem Kopf oder seiner Schulter oder, während Vater aß, vor ihm auf dem Tisch.
Ich weiß nicht, was das war, daß die Tiere, ganz gleich, welcher Art, auf Vaters stille Weise mit ihnen umzugehen, zahm und zutraulich wurden. Es wäre eine Geschichte für sich, von dem Kater Peter und meinem Vater zu berichten oder von Karl und Gretchen, einem schweren Hahn und einer Henne, die ihm zur allmorgendlichen Begrüßung auf die Schultern flogen. Vater ging auch mit uns Kindern in dieser stillen, gütigen Art um. Ich habe nie bei ihm Disziplinschwierigkeiten beobachtet. Er konnte herrlich mit uns spielen. So viel ich auch darüber nachdenke, es bleibt sein Geheimnis, wieso wir Kinder sowohl wie die Tiere ihn liebten und uns seiner Führung widerspruchslos anvertrauten. Auch meine Mutter spielte viel mit uns, aber unser Familienleben ging damals noch, als ich ein ganz junges Kind war, fast ganz im Leben des Hauses auf.
Nebengebäude Stern Strasse
Anschließend an das Hinterhaus, mit Front zur Sternstraße, schlossen sich 2 weitere 3geschossige Gebäude an. Sie müssen später erbaut worden sein. Damals enthielten sie das Mädchenwaisenhaus. Kleiner an Kinderzahl, waren in den Häusern auch die Lehrerwohnungen. Für mich waren damals die durch Mauer und Zaun abgegrenzten Häuser uninteressant. Jahre später wohnten wir drin, zeitweise als Hausgenossen des Kasseler Oberbürgermeisters und mit Professor Schafft zusammen. In einem der Häuser war auch einige Jahre mal ein Kindergarten, und als wir jugendbewegte Teenager waren, da waren die Räume an unseren Bund vermietet. Wir Wandervögel hatten dort unser »Nest«. Ja, und hier muß ich ein ganz wichtiges Kapitel meines Lebens ausklammern. Mir ist es wichtiger, in die frühe Kindheit zurückzudenken.
Das Wirtschaftshaus
Ein 2flügliges, im Winkel gebautes Haus, auch 3geschossig, stand mitten im Gesamtkomplex. Es war zum größten Teil Wirtschaftshaus. Im Winkel des Gebäudes gab es den »Brunnen«, der zu meiner Kinderzeit schon mit Wasserleitung versorgt war, aber noch einen steinernen Trog und Aufbau hatte. Hier kann ich gleich von den »Kanälen« erzählen, 3 oder 4 Gullis wurden von Zeit zu Zeit gereinigt und dabei zuzusehen, wenn die Kanalreiniger in die Tiefe stiegen, fand ich recht spannend, ebenso wie das im Obstkeller gelegene ausgemauerte offene Wasserloch. In seine unterschiedliche Tiefe und Dunkelheit träumte ich manches Geheimnisvolle, gruselig, aber ohne Angst. Beide Keller, Kartoffel- und Obstkelter, also die der ältesten Häuser, waren stabile Gewölbe, die im 2. Weltkrieg meinen Eltern das Leben retteten.
Die Hälfte des Untergeschosses des Wirtschaftshauses war das sogenannte Kohlenhaus. Kohlenträger, das Amt wechselte wie alle Ämter, arbeiteten paarweise. Sie trugen die Kohlen in einem Holzstunz, durch dessen Griffe eine stabile Holzstange gesteckt wurde, auf der Schulter. Rechts durch den eigentlichen Hauseingang erreichbar, lag die Waschküche mit tiefer gelegtem Fußboden, daher mit Fenstern, durch die ich nie hinausschauen konnte. Die Anstaltswäsche wurde wöchentlich von der Wäscherei Jakob mit Pferdegespann abgeholt und gebracht. In der Waschküche wuschen nur wir paar Familien. Aber es gab darin jedes Jahr ein Fest. Wir nannten es »Kirmes«. Da wurde das im großen Garten geerntete Kraut eingehobelt. Wochen vorher schon waren die riesigen Fässer, die in einem Keller unter der Freitreppe ihren Platz hatten, gereinigt und standen zum Lüften dann auf dem Hof bis zum Hobeltag. Über blitzsauberen Waschkörben lagen die Hobel, ich hüpfte drumherum und sah zu, wie sich Berge feinen hellen Krautes in den Körben häuften, gesalzen wurde und dann in die Fässer, die nun wieder an ihrem Ort standen, eingestampft wurden. Dieser Tag wurde als Festtag begangen. Abends gab es Kakao und Brötchen: etwas ganz Besonderes. Es war ja Kriegszeit. Auch das Muskochen in einem Kessel, der in der Waschküche stand, war ein Festtag, aber hier ist bei mir eine Erinnerungslücke. Vater, eine Gruppe Jungen und ich dabei, zogen mit Wagen voll Birnen und Pflaumen zu einer Kelterei in der Obersten Gasse, einem wunderschönen alten Haus, auch im Bombenhagel total zerstört. Wie haben wir den Obstbrei wieder heimgekriegt? Ich weiß es nicht mehr, aber ich rieche noch den sauersüßen Geruch der Kelter.
Hinter der Waschküche lag ein ganz wichtiger Raum, das Badehaus. Da standen rings an den Wänden große Badewannen, der Boden war mit Holzrosten ausgelegt. und ein Riesenbadeofen heizte. Samstags kamen gruppenweise die Jungen, mit einem in ein Handtuch eingerollten Päckchen frischer Wäsche unter dem Arm zum Bad. Hinterher mußten sie über den Hof rüber ins Haus flitzen, um sich nicht zu erkälten. Für meinen Vater war Samstag ein harter Tag, wenn alles programmgemäß klappen sollte. Auch die Familien badeten im Badehaus, aber unsere Mutter badete uns Kinder meistens in der Wohnung. Das war allemal ein Gepolter, wenn die Jungen die steile, schmale Holztreppe hinauf und hinunterstürmten! Drüben in den alten Häusern klang das auf den breiten Steintreppen hell, ich fand immer »lustig«.
Im Gang, der durch die ganze Hausbreite lief im 1. Stock, gab es an der Nordwand Fenster, links, die ganze Wand entlang, hingen in halber Höhe Schränke für die Schuhe und das Putzzeug. Darunter standen Reihen Bänke. Die Jungen hatten damals noch feste Rindlederstiefel, die täglich mit Schuhfett blitzblank gewichst wurden. Gegen Kriegsende trugen wir alle Holzsandalen, was ein fürchterliches Geklapper auf den Steinfußböden gab. Alle Räume in dem 1. Geschoß waren Vorratsräume. Wir sagten dazu: die Kleiderkammern. Der große Eckraum mit Südund West-Fensterreihen war die Schneiderstube. Da war ich gern. Aber auch hier ist eine Gedächtnislücke, denn ich kann mich nur an Wintertage erinnern, an denen wir dort gewerkelt haben. Da standen niedrige Tische im großen Karree mit vom Gebrauch blankgewetzten Eichenholzplatten. 6 oder 8 Lampen mit grünen Schirmen hingen von der Decke. Unter jeder hockten im Schneidersitz im Kreis 5 Jungen und waren am Knöpfeannähen, flicken, säumen usw. Ab und zu hörte man »Schere« oder »Zwirn«, Was dann zugereicht wurde. Alle waren fleißig, zeigten ihre Arbeit meinem Vater, wurden beschieden, verbessert, mußten manchmal wieder auftrennen und dabei wurde erzählt. Wurde es zu laut, klopfte Vater mit dem Schlüsselbund auf den Tisch. Dabei bullerte in der Ecke ein Ofen, in dem auch Bügeleisen heißgemacht wurden, mit denen die »Bügler« zischend über die gefeuchteten Stoffteile fuhren. In der Schneiderstube war es immer urgemütlich, und mir wurde da die Zeit nie zu lang.
Die Krankenstation - Bauernhof und Lebertran
Wenn ich zurückdenke, war es doch eine Menge, was die Jungen damals lernten. Kamen sie nach der Schulzeit in eine Meisterfamilie, uff ein Handwerk nach ihrer Neigung zu erlernen, gingen sie mit einer ordentlichen Schulbildung und einer ganzen Reihe manueller Fertigkeiten aus dem Haus. Wahrhaftig, eine gute Grundlage für ihr Leben kriegten sie mit. Im Obergeschoß dieses Hauses waren die lichten Süd- und Westzimmer Krankenstation, der Rest des Stockwerks die Wohnung der Krankenpflegerin, auch einer Witwe mit schon erwachsenen Kindern, ziemlich stabil gebaut und auch nicht zimperlich. O wie gern wäre ich mal krank auf der Krankenstation gewesen! Da stand nämlich ein richtiger Bauernhof zum spielen. Nur von weitem konnte ich ihn bewundern, kriegte ihn aber niemals vom Schrank heruntergeholt zum spielen. Da muß ich gleich vom Kranksein erzählen. Ich wurde nicht krank. Mein Brüderchen hatte immer mal was und wurde dann ganz lieb versorgt. Einmal hatte er Diphterie und kam ins Krankenhaus. Ich sollte prophylaktisch eine Spritze kriegen und habe ein fürchterliches Gezeter angestellt: »Ich bin nicht krank und ich werde auch nicht krank«, aber unseren alten Herrn Geheimrat rührte das nicht, nur krank wurde ich wirklich nicht, bis ich mal, als die halbe Belegschaft Mumps hatte, sie auch bekam, aber so leicht, daß mir meine Mutter einen dicken, roten, kratzigen Wollschal umband und sagte: »Geh ein bißchen raus in die Sonne, dann ist es schnell wieder vorbei.« O wie tief enttäuscht war ich.
Auf der Krankenstation gabs auf dem Gang draußen ein Tischchen mit einer großen Medizinflasche voll Lebertran. Hatte sich einer daneben benommen, hieß es: »Hol dir einen Löffel Dicken«. Da musste der Übeltäter einen Löffel Lebertran schlucken. Ausgenommen war ich davon nicht, wenn mir der »Genuß« auch selten zukam. Auf alle Fälle war es eine recht gesunde Strafe.
Kinderspiele
Das letzte Gebäude, was ich nun noch beschreiben muß, war die Halle. Sie war ziemlich groß und lag mit ihrer geschlossenen Seite am Garten. Vorn und in der Mitte wurde sie von 2 Reihen Holzsäulen auf Sandsteinsockeln getragen. An der gesamten Hinterwand war eine Tafel angebracht, auf der wir nach Herzenslust malen konnten. An beiden Enden befanden sich Holzställe und unter dem Dach der Strohboden. Jahre später half ich auf dem Strohboden mit, Matten zu binden für die Mistbeete. Wintertags wurden auf den glatten Steinfußboden ein paar Eimer Wasser gekippt und wir hatten herrliche »Glietebahnen«. Ich kleines Ding wurde von meinen Freunden in die Mitte genommen und im »Kitzchen« (zusammengekauert) über die Bahn geschlittert.
Mitten im Gebäudekomplex lag unser großer Spielplatz, um die Häuser herumgepflastert, die große Fläche mit feinem Kies beworfen. Ich weiß nicht mehr wieviel, auf alle Fälle eine stattliche Zahl alter Ahornbäume wuchs darauf. Einen mit hellem Stamm und buntem Laub liebte ich besonders. In der Mitte gabs eine Linde, um die herum Bänke ohne Lehne standen, auf denen wir regelmäßig Trocken-schwimmen übten. Rings standen Bänke mit schön geschwungenen Eisenbeinen. Ebensolche hielten und zierten die Lehnen. Was für Kinderglück waren unsere Spiele und Tobereien in der Freistunde, oft mit meinem Vater gemeinsam. »Fuchs heraus auf einem Bein«, »Paarlaufen«, »Räuber und Schandeckel«, »Schlagball«, Völkerball und was wir so alles kannten und uns ausdachten. Ich hüpfte schon als kleines Ding dazwischen herum, wurde später eine begehrte Partnerin. Fußball wurde damals noch nicht gespielt.
Das verlorene Paradies
An den Spielplatz schloß sich, zaungetrennt, ein Rasenplatz, die »Bleiche« genannt und auch als solche benutzt. Aus früherer Zeit standen im Eingang zur Bleiche zwei gestutzte dicke Linden, die nun wieder austrieben. Unter einer war meine »Lindenlaube« und mein Gärtchen, in das ich Gänseblümchen und Löwenzahn pflanzte, kleine Beete mit Steinen umlegte und mich meiner Lieblingsbeschäftigung hingab, in dem huscheligen, dämmergrünen Eckchen zu träumen. An die Bleiche schloß sich in West-Südrichtung, vom Bogen der Stadtmauer begrenzt, unser großer Garten, mein verlorenes Paradies!
Ich hatte mich darauf gefreut, von diesem wunderschönen Garten zu erzählen, aber ich finde nicht die Worte für das alle Jahre meines Daheimseins überdauernde Glück, was mir dieser Garten schenkte, und das ich immer nur ganz eng mit dem Bild meines Vaters denken kann, von der Liebe bewegt, mit der er uns umgab und mit der ich ihm anhing. Wenn Vater mit den Jungen im Garten arbeitete, war ich ganz bestimmt mit dazwischen. Weiträumig, mit hohen Obstbäumen bester Sorten bestanden, durchzogen vom Blütenduft, vergaß man, daß man in einer Großstadt lebte. Interessant war die alte Mauer. Schattenmorellen standen davor, im Frühling schön anzusehen, wenn sich das leuchtende Blütenweiß gegen die dunkle Mauer abhob. An ihrem Ende gabs die ummauerte »Bromse«, wohin mit Schubkarren aller Gartenabfall zum Kompostieren gefahren wurde. An der Ostseite lagen Reihen von Mistbeeten, alljährlich ein Ereignis, wenn Militärgespanne den Mist anfuhren. Der breite Hauptweg war mit Hortensien bepflanzt. Nirgendwo wieder habe ich solche Blütenfülle erlebt. Wie Zauberei kam mir’s vor, wenn mein Vater mit einer Hand voll rostiger Nägel, unter die Pflanze gegeben, die Blütenfarben intensiver zu bekommen versuchte.
Auch die Familien des Hauses hatten ihre eigenen Gartenecken. Unser Garten lag entlang der Sternstraße, hatte auch ein rosenumwachsenes Gartenhäuschen, aber als junges Kind war ich lieber im großen Garten, Nie vergessen kann ich, wenn Vater uns in jedem Sommer mit den ersten Erdbeeren aus unserem Garten überraschte. Fein ausgewählte Früchte trug er in einem Rhabarberblatt für uns Kinder und für Mutter die ersten erblühten Moosrosen,die sie sehr liebte und deren Duft mir bis heute der lieblichste aller Rosendüfte zu sein scheint. Unvergessen auch aus der Zeit, als wir schon größer waren, wenn er uns eine Schale der schönsten Forellenbirnen brachte und sie uns feierlich mit dem Gedicht »des Herrn Riebeck auf Riebeck im Havelland« überreichte.
Unternehmungen im Umfeld
Gern saß ich auch bei den Jungen, am liebsten in der Oberklasse, wenn Vater Dienst in der Arbeitsstunde hatte. Er diktierte dann und während die Jungen schrieben, malte ich, bis uns die Glocke zur Freistunde und unseren Spielen rief. Sommertags gingen wir regelmäßig um diese Zeit schwimmen, damals noch in die, auf dem rechten Fuldaufer gelegene Gerhardsche Badeanstalt, von uns auf kurzem Weg erreichbar. Trocken geübt war das Schwimmen von allen. In der Badeanstalt wurde dann immer eine Gruppe Nichtschwimmer an die Longe genommen. Ich war dazu – als noch zu klein – nicht ausgewählt, dachte mir ein anderes Verfahren aus, ließ ein Bein auf dem Boden und paddelte mit Schwimmbewegungen durchs Becken. Ab und an das Standbein abhebend, konnte ich sehr bald schwimmen und so sicher, daß ich ein rotes Kreuz auf den Badeanzug genäht bekam als Zeichen Schwimmer zu sein, bis ich später irgendwann mal das offizielle Freischwimmen mitmachte und außerhalb der Badeanstalt auf den verankerten Holzkreuzen herumtoben durfte.
Im Winter zogen wir bei Schnee zum Tannenwäldchen zum Schlittenfahren. Puh, ich spüre noch den angepappten, vereisten Schnee, der den Mantelsaum steif gemacht, nach einer Weile die Schenkel wund rieb, was aber auf gar keinen Fall Grund war, nicht weiterzumachen. Waren die Teiche in der Aue zugefroren, zogen wir in die Aue zum Küchen- oder Hirschgraben und tobten uns da aus. Schlittschuhe besaß ich nie. Der Krieg ließ das Schuhwerk knapp sein und solcher »Luxus« lag nicht in unserem Vermögen. Damals nahm ichs als selbstverständlich hin. In späteren Jahren, als meine Klassenkameradinnen mit Schlittschuhen aufs Bassin zogen, gegen Eintritt mit Musik dort liefen, zog Bitterkeit ein, von der ich in weiteren Jahren noch mancherlei schlucken mußte.
Auf die Sonntage freute ich mich immer, besonders auf die, an denen Vater Dienst hatte. Morgens war Kirchgang. Vorher »Appell«. Unsere Jungens zogen immer tipptopp los in ihren dunkelblauen Uniformen. Ich ging gern zur Kirche und ich bin sicher, daß ich den Kirchgang kaum einmal versäumte. Ging ich mit Mutter, saß ich mit ihr zwischen der Gemeinde im Kirchenschiff, sonst aber war mein Platz zwischen den Jungen auf den letzten 3 Bänken des Schiffes. Ich blieb auch noch zum Kindergottesdienst, an dem unsere Jungen nicht teilnahmen. Die Verbindung kam durch die erwachsene Tochter unserer Pförtnerin, die im Jungmädchenbund war und Helferin im Kindergottesdienst. Mariechen Neutze hieß die Leiterin meiner Gruppe, ein liebes freundliches Mädchen. Ganz selbstverständlich war damals mein Glaube. In langen Gebeten sagte ich abends Gott alles und fühlte mich unbedingt sicher in seiner Hut.
An Vaters Dienstsonntagen zogen wir ins Gelände, z. B. hinauf zum Sandershäuser Berg. Vater hatte uns von einer dort stattgefundenen Schlacht erzählt, was uns die Gegend besonders interessant sein ließ. Wir liebten die Spiele, die uns das Gelände dort erlaubte, sehr. Weit in den Wald, bis zum Fuldatal hinunter trieben wir uns. Vater besaß eine Trillerpfeife, die uns, wenn es Zeit war, zurückholte. An Herbsttagen ging’s zum Drachensteigen auf die Waldauer Wiesen. Solche Drachen gab es nur einmal! Nie wieder habe ich so herrliche Exemplare gesehen, teilweise – und das waren die schönsten – achteckig und sehr groß. Sie waren das ganze Jahr sorgfältig aufbewahrt und ich weiß, daß Vater sehr bedacht darauf war, sie zu erhalten und zu erneuern. Briefchen auf Briefchen, mitunter auch ein Taschentuch schickten wir hinauf, wenn sie nur noch als Pünktchen erkennbar, an der langen Schnurr wippten. »Er macht Deten« hieß es, wenn einer nicht gut ausbalanciert zu schwanken anfing. Dann wurde mit Eifer Schwanz – oder Ohrengewicht ausgeglichen, bis er ruhig stieg. Zu Jahrmärkten wurden wir regelmäßig von der Messeleitung eingeladen, hatten freien Zutritt zu allem Rummel. Die Karussellmusik machte mir immer Bauchweh, aber das wurde tapfer ertragen. Ich fuhr am liebsten Achterbahn. Auch ins Theater wurden wir eingeladen und zu mancherlei Weihnachtsbescherungen von Vereinen. Aber das sind schon Erinnerungen des größeren Kindes, ich wollte nur aus den ganz frühen, ganz glücklichen Jahren erzählen.
Ach das «Waisenkind»
Schon im 2. Schuljahr besuchte ich die weiterführende Schule in der Stadt. Damals bauten auch diese Schulen mit der Grundschule auf. Ich war durch unsere Hausschule ein Jahr zu früh zur Schule gekommen und konnte gleich ins 2. Schuljahr aufgenommen werden. Aber da fingen auch schon die ersten Probleme für das Kind an: «Ach aus der Bettenhäuser Straße», «Ach das Waisenkind», das waren so die ersten abfälligen Bemerkungen, die ich unbegriffen schlucken mußte. Ich war doch so glücklich als «Waisenkind», und es gab doch für mich überhaupt nichts Schöneres als unser großes Haus mit allem, was dazu gehörte. Ich war nur Liebe gewöhnt. Jetzt wurde ich scheel angesehen, stehengelassen, von Spielen ausgeschlossen. Bisher, bei unseren Jungen, hatte ich mich, wenns nötig war, stets durchgesetzt. Um mich war immer eine Gruppe «Freunde», die zur Stelle war, wenn mir einer was wollte. Was nun? Mein Weg wurde buckelig. Das Glück meiner frühen Zeit war hin! Aber Gott sei gedankt für jede Stunde dieser behüteten, frohen Kindertage.
Es gab für das Waisenhaus im Wandel der Zeit mancherlei Umstellungen, baulicher sowohl wie pädagogischer Art. Vater arbeitete bis zu seiner Pensionierung im Haus. Dann wurde es im 3. Reich durch die NSV übernommen und in seiner bisherigen Form aufgelöst. Nichts mehr von allem ist übriggeblieben im Bombenhagel des 2. Weltkrieges. Heute rollt der Verkehr darüber.
Text: Emilie Wilhelm, 1978
Einleitung: Hans-Dieter Credé, 2015
Editor: Erhard Schaeffer, März 2023
Quellen:
- Vom Waisenhaus zur Kita 1690–2015, kassel university press GmbH, Kassel, Hans-Dieter Credé (Hg.) 2015
- Stadtmuseum Kassel, 2023
- Archiv der Waisenhausstiftung
- Archiv ev. Kirche Unterneustadt
Dokumente zum Herunterladen
Wo spielt dieser Beitrag?
Kurzbeschreibung
Glückliche Kindheit (1916–1919) von Emilie Wilhelm mit einer Einleitung von Hans-Dieter Credé. »Groß wie ein Schloss ist das Haus und der Garten reicht bis an den Himmel.« An diese Worte erinnerte sich Emilie Wilhelm, als sie im Alter von 67 Jahren »ein paar Seiten eines Bilderbuches« aufschlug, um von ihrer »glücklichen Kinderzeit« zu berichten. Sie dachte dabei an die Jahre, in denen auch sie im Reformierten Waisenhaus zu Kassel gelebt hatte.
Artikel Kategorien
- Stadtplanansicht
- Straßen
- Agathofstraße [9]
- Am Försterhof [2]
- Am Holzmarkt [4]
- Am Messinghof [1]
- Am Sälzerhof [2]
- Autobahnauffahrt Kassel-Nord [1]
- Bergshäuser Straße [3]
- Bettenhäuser Straße [3]
- Bunte Berna [4]
- Buttlarstraße [5]
- Christophstraße [1]
- Dormannweg [8]
- Eichwaldstraße [14]
- Eschenweg [2]
- Faustmühlenweg [4]
- Forstfeldstraße [2]
- Gecksbergstrasse [1]
- Hafenstraße [3]
- Heiligenröder Straße [3]
- Heinrich-Steul-Straße [5]
- Huthstraße [4]
- Inselweg [2]
- Jakobsgasse [1]
- Kalkbergweg [1]
- Königinhofstraße [2]
- Leipziger Straße < Leipziger Platz [37]
- Leipziger Straße > Leipziger Platz [9]
- Miramstraße [4]
- Ochshäuser Straße [5]
- Olebachweg [1]
- Ölmühlenweg [4]
- Osterholzstraße [8]
- Pfaffenstieg [1]
- Pfarrstraße [7]
- Radestrasse [4]
- Salztorstraße [2]
- Sandershäuser Straße [9]
- Söhrestraße [2]
- Steinigkstraße [7]
- Unterer Käseweg [2]
- Waisenhausstraße [2]
- Waitzstraße [1]
- Wallstraße [1]
- Windhukstraße [2]
- Wohnstraße [2]
- Yorkstraße [1]
- Stadtansicht
- Alt Waldau [6]
- Alter jüdischer Friedhof in Bettenhausen [1]
- Blücherviertel [6]
- Dorfplatz an der Losse [37]
- Drahtbrücke Kassel [1]
- Eichwald [14]
- Erlenfeld [7]
- Fieselersiedlung im Stadtteil Forstfeld [2]
- Flugplatz Kassel-Waldau / Industriegebiet Waldau [6]
- Forstfeld [25]
- Forstfelder Mitte [1]
- Friedhof Bettenhausen [2]
- Fulda-Schifffahrt [7]
- Fuldabrücke Kassel [4]
- Gerhard-Fieseler-Flugzeugwerke [8]
- Hafen Kassel [3]
- Hafenbrücke [2]
- Häschenplatz, Ochshäuser Str / Forstbachweg [4]
- Hessendenkmal am Waldauer Fußweg [1]
- Industriegebiet Lilienthalstrasse 150 [4]
- Industriegebiet Lilienthalstrasse/Wohnstrasse [12]
- Junkerscamp "Lettenlager" [8]
- Kasseler Forst [13]
- Kasseler Osten [20]
- Kunigundishof [2]
- Leipziger Platz [6]
- Munitionsfabrik 1916 [3]
- Quellgebiet der Eichwasserleitung [2]
- Salzmannshausen [14]
- Schröderplatz Forstfeld [5]
- Siedlergemeinschaft Lindenberg 1 [2]
- Spielplatz Osterholzstraße [1]
- Stadtschleuse und Walzenwehr [3]
- Unterneustadt [23]
- Wahlebach [4]
- Gebäude
- Altes Bürgermeisteramt [2]
- Altes Tor der Neustadt [1]
- Bahnhof Bettenhausen [4]
- Bahnhof Bettenhausen der Söhrebahn [2]
- Betriebshof Sandershäuser Straße [2]
- Bürgerhaus Waldau [2]
- Bürgerschulen 25 und 26 [7]
- Charité / Salzmanns Hof [4]
- Das "Große Maul" [1]
- Diana Werke [1]
- Ehemaliges Forstgut in der Ochshäuser Straße [2]
- Eisenhammer [4]
- Ev. Immanuelkirche Forstfeld [4]
- Ev. Jakobuskirche Eichwald [1]
- Ev. Marienkirche Bettenhausen [7]
- Fachwerkhaus Leipziger Straße 321 [1]
- Firma Pilzegrimm [2]
- Forstlehranstalt Waldau [4]
- Frw. Feuerwehr Bettenhausen/Forstfeld, DRK Bettenhausen/Waldau [3]
- Gasthaus "Zur Römerhalle" [2]
- Gaststätte Insel Helgoland [3]
- Gaststätte Nadler-Thalia [3]
- Gaststätte Zum Osterholz [3]
- Gaswerk Nürnberger Straße [1]
- Haferkakaofabrik/Schüle-Hohenlohe [3]
- Hallenbad-Ost [2]
- Hassia Drogerie [1]
- Haus Forstbachweg [4]
- Heilsarmee Sozial-Center-Kassel [1]
- Jägerhaus / Kastell [2]
- Kadruf [2]
- Kindertagesstätte Forstbachweg [1]
- Kindertagesstätte Lindenberg [1]
- Kupferhammer [1]
- Lilienthalstraße 1 [1]
- Lossekraftwerk [1]
- Lossemühle Agathof [3]
- Messinghof [2]
- Molkerei Krell [2]
- Postamt Bettenhausen [1]
- Pulvermühle / Herkulesbrauerei [2]
- Salzmann & Comp. [10]
- Schmiede Waldau [1]
- Schule Am Lindenberg [5]
- Schützenhaus [1]
- Seniorenwohnanlage Lindenberg [1]
- Siechenhof [2]
- St. Kunigundis - Kirche [5]
- St.-Andreas-Kirche Forstfeld [1]
- Stadtteilzentrum Agathof [16]
- Theater des Osten / Restaurant Belz [4]
- Treffpunkt Samowar [1]
- Unterneustädter Mühle [2]
- Wartburghütte Niestetal [3]
- Wollwäscherei Mosbacher [1]
- Zehntscheune Waldau [2]
- Kultur
- Erlebte Geschichte
- Familienfest
- Feier
- Unternehmen
- Organisationen
- Menschen
- Frühgeschichte
- Mittelalter
- 13. Jahrhundert
- 14. Jahrhundert
- 15. Jahrhundert
- 16. Jahrhundert
- 17. Jahrhundert
- 18. Jahrhundert
- 19. Jahrhundert
- 1900er Jahre
- 1910er Jahre
- 1920er Jahre
- 1930er Jahre
- 1940er Jahre
- 1950er Jahre
- 1960er Jahre
- 1970er Jahre
- 1980er Jahre
- 1990er Jahre
- 2000er Jahre
- 2010er Jahre
- 2020er Jahre